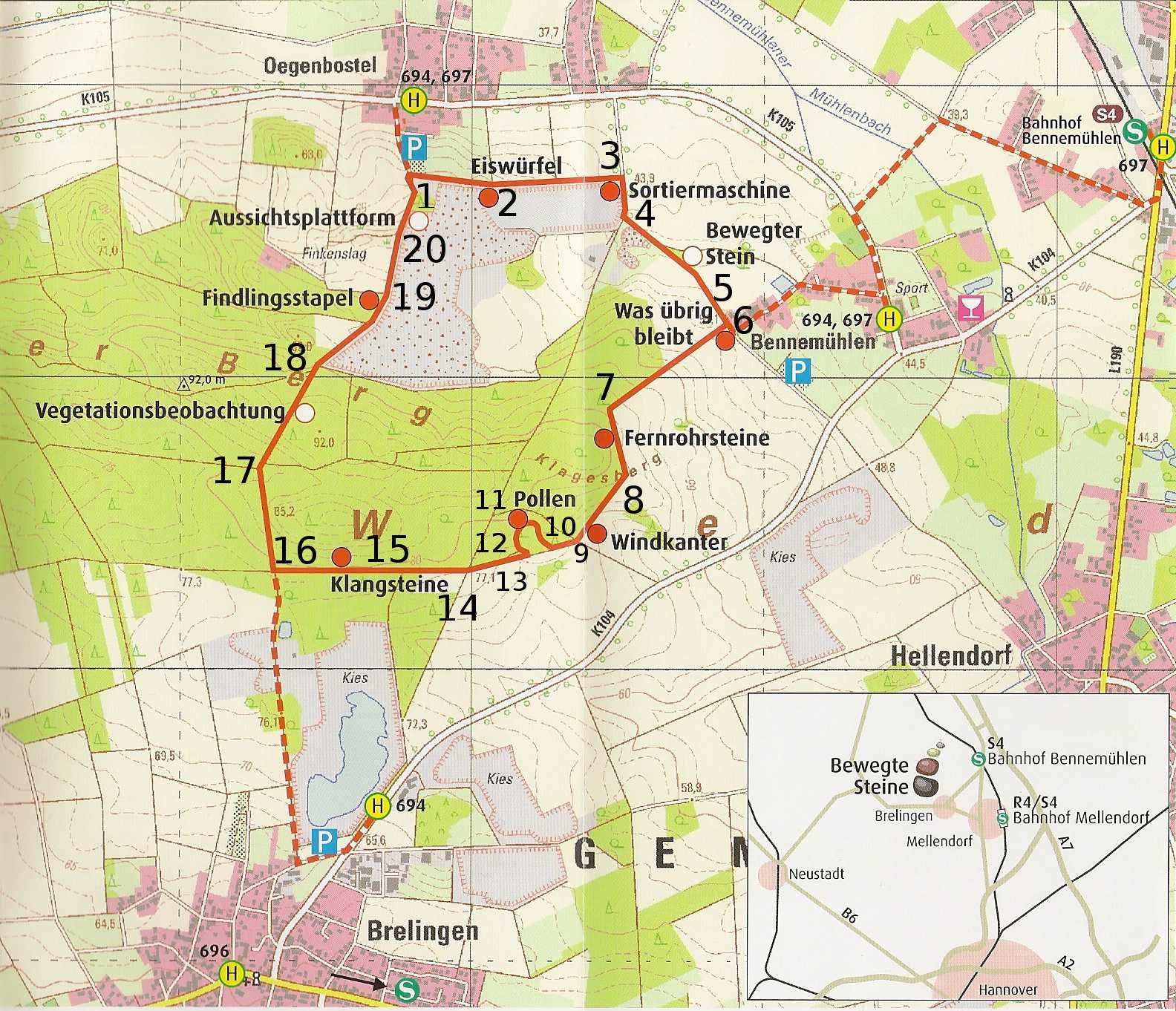Die Wegweisersteine


Hardeberga-Sandstein: Der Hardeberga-Sandstein gehört zu den wenigen in Brelingen aufgestellten Sedimentgesteinen. Er ist einer von verschiedenen nordischen unterkambrischen Sandstein-Typen, die alle ein Alter von etwas mehr als 500 Millionen Jahren haben. Die Lebewelt auf und unter der Oberfläche eines Sandwattes dieser Zeit bestand aus wühlenden Lebewesen und Gliedertieren mit einer kriechenden Lebensweise auf dem sandigen Meeresgrund. Die dabei erzeugten Spuren gehören zu den ältesten fossilen Lebensspuren. Das Gestein stammt von Schonen in Süd-Schweden.


Tertiärquarzit: Tertiärquarzite gehören nicht zu den Geschieben, sind also nicht von nordischer Herkunft. Die eiszeitlichen Schichten von Brelingen bestehen zu einem großen Teil aus Sand und Kies der Weser, die in einer Zeit vor der erstmaligen Vereisung von Hameln über Hannover und Brelingen (Hannoverscher Weserlauf) nach Westen Richtung die Niederlande abfloss. Diese Weserablagerungen enthalten keine nordischen Gesteine, ist dies doch der Fall, muss man vermuten, dass die Flusssedimente später in der Eiszeit umgelagert wurden. Während noch im Stadtgebiet von Hannover die Kiese völlig frei sind von nordischen Bestandteilen ist dies in den Brelinger Bergen nur teilweise der Fall. Die genauen Ursachen hierfür sind umstritten.
Jedenfalls ist es so, dass die Flussschotter der Weser in Brelingen untergeordnet aus sehr großen Geröllen bestehen. So erreichen Basalt-Blöcke Durchmesser von 0,5 m, Buntsandsteinplatten Längen von mehr als 1 m, Kieselschiefer 0,4 m und Tertiärquarzite in Einzelfällen weit mehr als 1 m und Volumen von mindestens 1 Kubikmeter. Das heißt, einzelne Blöcke südlicher Herkunft sind schwerer als 1 t. Die Weser ist der größte Fluss zwischen Rhein und Elbe und man darf ihr zutrauen, dass sie vereinzelt dm-große Blöcke im Flusswasser rollend bis nach Brelingen und nachweislich darüberhinaus noch 50 km nach Westen transportieren kann. Zweifel kommen aber bei den großen, spezifisch sehr schweren Basaltblöcken auf. Deren nächstgelegene Vorkommen liegen im südniedersächsischen Bergland. Die zu den Basalten verwandte Gesteinsart „Phonolith” stammt mindestens vom Vogelsberg in Hessen, wahrscheinlicher aber von der Rhön im Einzugsgebiet der Werra. Für diese Zentner-schweren Blöcke muß man gedanklich auch den Transport auf Eisschollen für möglich halten. Ein Zentner-schwerer Block kommt in der Natur auf Eisschollen nie allein zu liegen, so dass man sich Wintereisschollen von mindesten 1 t, wahrscheinlicher aber von vielen Tonnen Masse vorzustellen hat.
Solche mächtigen Eisschollen sind für die Weser historisch kaum überliefert, die Vorgänge wären dann unter deutlich kühleren Verhältnissen als heute geschehen. Zu den Gesteinen südlicher Herkunft gehören Tertiärquarzite. Man kann sie als Zeugensteine für die der Eiszeit vorangegangenen Zeit, die Tertiärzeit ansehen. Schneeweiße Sande der mittleren Tertiärzeit findet man heute noch im südlich gelegenen Bergland. An einigen Stellen sind diese Sande durch chemische Ausfällung von Kieselsäure extrem verfestigt. Hierdurch besitzen die Steine eine hohe mechanische Festigkeit sowie extreme chemische Widerstandsfähigkeit. Vor der ersten Vereisung sind sie dann in den Brelinger Raum verfrachtet worden. Dies dürfte jedenfalls für die meisten Süßwasserquarzite in den Schottern von Brelingen gelten. Einzelne Blöcke wie der aufgestellte Süßwasserquarzit von mehr als 1 t sind nun allerdings so groß, dass auch Zweifel am Transport durch Flusseis-Schollen aufkommen. Vielleicht lagen diese besonders großen Steine schon auf den Kreide-zeitlichen Tonen von Brelingen, bevor die Weser das Gebiet erreichte. Beständig genug sind sie jedenfalls und ihre Bedeutung als Zeugenstein für die ehemalige Ablagerung von Tertiärsand im Brelinger Raum wäre dann gegeben. Jedenfalls wird der aufgestellte Stein auch zukünftig noch Millionen Jahre bestehen (wenn er nicht künstlich zerstört wird), mit Sicherheit aber alle anderen Steine von Brelingen überdauern.